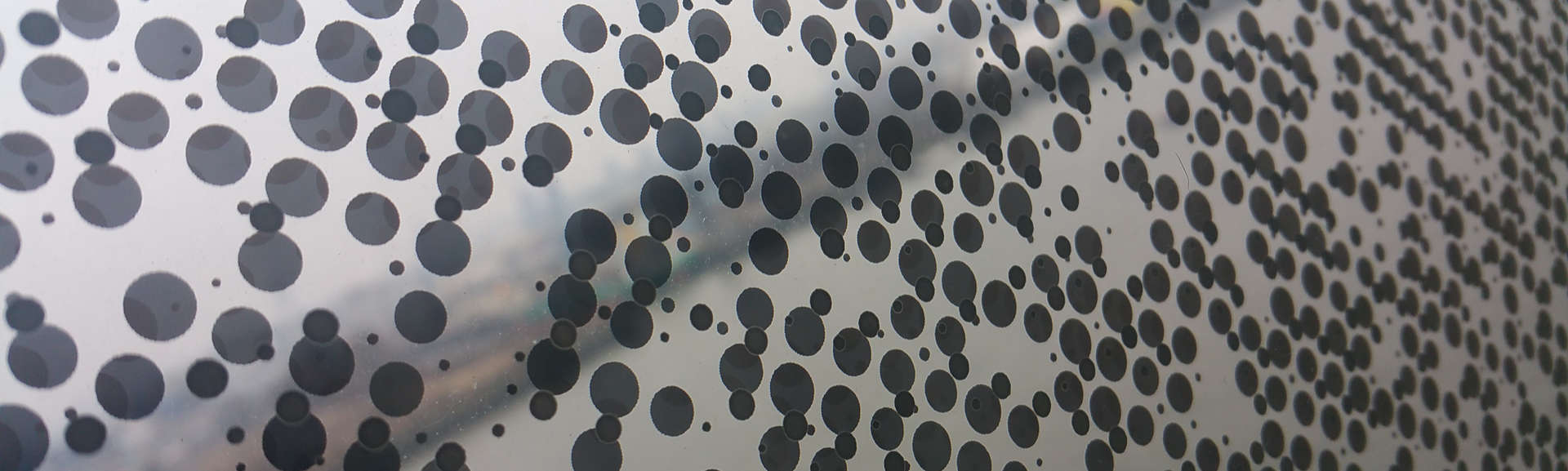Roher und brutaler? Die Bildsprache seit dem 11. September
Erinnern Sie sich noch an die ersten Bilder, die Sie vor 20 Jahren von den Terroranschlägen des 11. Septembers gesehen haben? Vermutlich waren es Livebilder von brennenden Gebäuden und Menschen in Panik. Es ist ein Szenario, das durch die wiederholten verheerenden Anschläge islamistischer Attentäter der letzten Jahre inzwischen zu unserem Alltag gehört – aber sind die Bilder, die wir zu sehen bekommen, auch brutaler geworden?
New York, 11. September 2001 am Vormittag: Die Zwillingstürme des World Trade Center stehen in Brand. Ihre aufgeschlitzten Fensterfronten, das lodernde Feuer, die schwarzen Rauchwolken werden weltweit und live im Fernsehen übertragen. Ein ikonisches, historisches Bild, das man zum 20. Jahrestag zeigen muss, sagt Tagesschau-Chefredakteur Marcus Bornheim. Denn die Brutalität des Anschlages habe damals den Feldzug der Amerikaner gegen die Taliban begründet. Auf andere Bilder von diesem Anschlag hingegen sollte man heute verzichten; sie sind zu grausam.
Es gab Bilder wie Bewohner, Mitarbeiter - als es gebrannt hat - runtergesprungen sind. Und diese kleinen Bildpunkte quasi konnte man damals im Fernsehen noch sehen. Das sind beispielsweise in meinen Augen Bilder, die man heute nicht mehr braucht, weil sie so dramatisch sind, dass man sie nicht mehr vorführen sollte. Das hat nichts mit dem terroristischen Akt zu tun, sondern da wird einfach nur menschliches Leid dargestellt, das man nicht braucht, um die historische Dimension dieses Ereignisses zu verstehen.
Die Hemmschwelle des Zumutbaren hat sich verschoben. Das hängt mit dem Bildmaterial zusammen, das heute auf den Markt strömt. Foto- und Videofunktionen in den Handies ermöglichen es, dass jeder und jede sofort, nah am Geschehen und ungefiltert Aufnahmen machen und im Internet veröffentlichen kann. Die sozialen Medien leben zudem von Bildern außergewöhnlicher Ereignisse und einer Selbstdarstellung, die bis zur Liveübertragung von Massakern durch Selbstmordattentäter reicht. Ist damit auch die Bildsprache brutaler geworden?
Vor 20 Jahren gab es gar nicht so starke Bildquellen, so viele Bildquellen, aus denen wir hätten schöpfen können, und deswegen entsteht, glaube ich, der Eindruck, dass wir heute gewaltvollere, rohere Bilder haben. De facto ist es aber eigentlich eine Tatsache, dass es einfach mehr Bildquellen gibt. Wir sind näher dran, weil die Menschen näher dran sind mit ihren Smartphones.
Auch bei den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten nach dem terroristischen Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charly Hebdo 2015 filmte ein Augenzeuge das Geschehen. Bis heute lässt sich die Veröffentlichung der Videoplattform Liveleak im Internet aufrufen. In den öffentlich-rechtlichen Medien wurde davon nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt und dieser zudem verpixelt. Denn bei aller Grausamkeit eines derartigen Ereignisses: Es nicht zu zeigen, wäre falsch, sagt Christoph Bangert, Professor für Fotojournalismus an der Hochschule Hannover.
Schwierige Bilder zu zeigen, ist schon auch wichtig, denn diese Ereignisse haben tatsächlich stattgefunden. Das ist keine Fiktion, das sind echte Menschen. Denn wenn es diese Bilder nicht gibt, und wenn die gar nicht stattfinden, dann haben wir uns selbst zensiert und es fehlt ein ganz entscheidender und wichtiger Teil dieser Ereignisse. Man muss natürlich unglaublich aufpassen, dass man nicht die Propaganda anderer wiederholt und dass man eben diese Dinge einordnet und eine Reflexion des Betrachtenden zulässt.
Christoph Bangert hat selbst viele Jahre als Fotograf aus Krisengebieten wie Darfur, dem Irak und Afghanistan berichtet. Sein gerade erschienenes Buch „Rumors of War“ ist ein Kriegstagebuch aus Afghanistan. Immer wieder ist die Verantwortung für den Bildinhalt dabei ein Thema. Er selbst versucht, nur Menschen in Krisensituationen zu fotografieren, die dem selbst zugestimmt haben, Auftraggeber definieren weitere Kriterien vor der Veröffentlichung.
Da gibt es zum Beispiel in der New York Times nicht die Regel, dass man keine toten Menschen zeigen darf. Aber natürlich sehr klar von Bild zu Bild und von Video zu Video muss man abwägen: Hat es eine Funktion? Hilft es den Leserinnen und Lesern, dies Ereignis einzuordnen, zu verstehen? Oder geht es darum, Aufmerksamkeit zu erregen?
Ikonenhafte Bilder wie die der brennenden Türme von New York bleiben für Christoph Bangart an der Oberfläche. Sie illustrieren das Ereignis, vertiefen es aber nicht.
Ich glaube, dass wir mehr in Bildstrecken arbeiten müssen auch, die Hintergründe zeigen müssen, auch bildnerisch. Und dann konkrete Geschichten erzählen, über konkrete Menschen und uns eben nicht nur auf diese einzelnen Bilder verlassen können.
Ob die Bildsprache roher geworden ist, lasse sich schwer messen, sagt Christoph Bangert. Sicher sei aber: es ist heute wichtiger denn je, sich bewusst zu machen, in welchem Kontext Fotos von Terroranschlägen veröffentlicht werden. Zudem müsse man sich heute für die Auswahl der Bilder stärker rechtfertigen als früher, sagt Marcus Bornheim, Chefredakteur in der Nachrichtenredaktion ARD-Aktuell.
Mein Eindruck ist, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren durch eine sehr kritische Öffentlichkeit auch stärker bei uns intern darüber nachdenken, wie verpixeln wir genau solche Szenen: Bataclan, Charlie Hebdo oder andere Attentate, wo wir Material haben, auch aus einem Social-Media-Bereich.
Beitrag für BR24

Neuere Themen:
![]() Mit guter Laune Barrieren einreißen - Buchempfehlung zum Welt-Down-Syndrom-Tag
Mit guter Laune Barrieren einreißen - Buchempfehlung zum Welt-Down-Syndrom-Tag
Glückstreffen – Promis, Down-Syndrom und der ganz normale Wahnsinn
![]() Mehr Frauen bei Wikipedia - Regionalbüro Hannover bietet Einführungskurse für Wikepedianerinnen an
Mehr Frauen bei Wikipedia - Regionalbüro Hannover bietet Einführungskurse für Wikepedianerinnen an
Wie Wikipedia Hannover den Anteil von Frauen in der Online-Enzyklopädie steigern will
Ältere Themen:
![]() Podcast "Endlagersuche: Irgendwo muss das Zeugs ja hin!"
Podcast "Endlagersuche: Irgendwo muss das Zeugs ja hin!"
Auftakt einer digitalen Konferenzserie der Stiftung Leben & Umwelt
![]() Herausragende Leseförderung mit digitalen Mitteln
Herausragende Leseförderung mit digitalen Mitteln
Das Projekt Hörpost an der Heinrich-Kielhorn-Schule Hameln